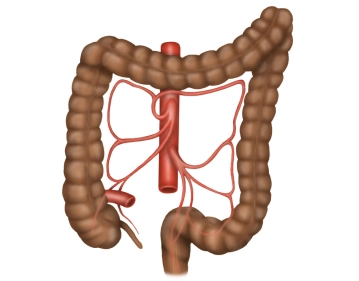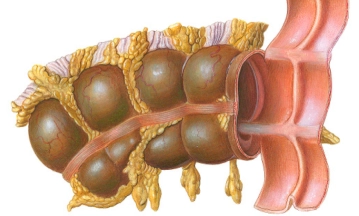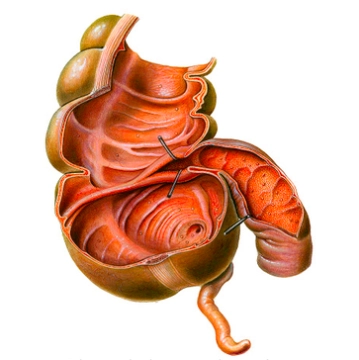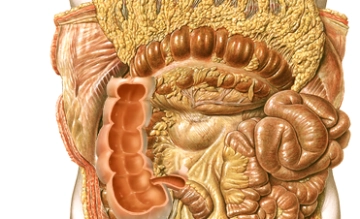Das Kolon umrahmt an der inneren Bauchdecke sowie unterhalb von Leber und Magen verlaufend die Dünndarmschlingen. Die Lage des Kolons ist intra- bzw. sekundär retroperitoneal. Die Funktion besteht hauptsächlich in der Eindickung des Speisebreis durch die Resorption von Wasser. Die Länge des gesamten Kolons beträgt im Mittel 120-150 cm. Das Kolon beginnt an der Ileozökalklappe und endet am rectosigmoidalen Übergang, wo es ins Rectum übergeht.
Unterteilt wird das Kolon in die Abschnitte:
- Zökum oder Cäcum mit der Appendix
- Kolon ascendens
- Kolon transversum
- Kolon descendens
- Kolon sigmoideum