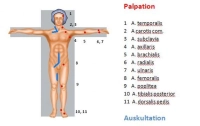Im Vergleich zu Verschlussprozessen der A. femoralis superficialis und proximaler gelegenen Arteriensegmenten führen Verschlüsse der kruropedalen Arterien aufgrund ihrer eingeschränkten Kollateralisationsmöglichkeiten häufig primär zu einer kritischen Extremitätenischämie. Davon besonders betroffen sind Diabetiker.
Endovaskuläre Therapieoptionen von infragenualen Verschlussprozessen sollten der Operation vorgezogen werden, sofern die zu erwartenden kurz- und langfristigen Ergebnisse vergleichbar sind. Dennoch gibt es auch heutzutage in ausgewählten Fällen eine primäre Indikation für die primäre Anwendung der pedalen und peripheren kruralen Bypasschirurgie:
- ausgedehnte Gewebsläsionen am Fuß (primäre Bypassanlage bietet stärkere Gewebedurchblutung im Vgl. zur endovaskulären Therapie → „straight to the foot“)
- komplexe, langstreckige Verschlussprozesse
- Versagen der endovaskulären Behandlung
Weitere Voraussetzungen sind:
- vertretbares Operationsrisiko
- angemessene Lebenserwartung
- anschlussfähiges peripheres Gefäß
Im Optimalfall erfolgt der Revaskularisation mittels autologem Bypassmaterial (z. B. V. saphena magna).
Filmbeispiel
- subtotale Stenosen der A. femoralis superficialis links
- Verschluss der A. poplitea Abschnitt I – III
- Teilverschlüsse aller Unterschenkelarterien
- Verschluss des primären und sekundären Fußbogens
Z.n. femoro-poplitealem Venenbypass rechts, autologe V. saphena magna verbraucht, links zu kaliberschwach → alloplastischer Bypass.