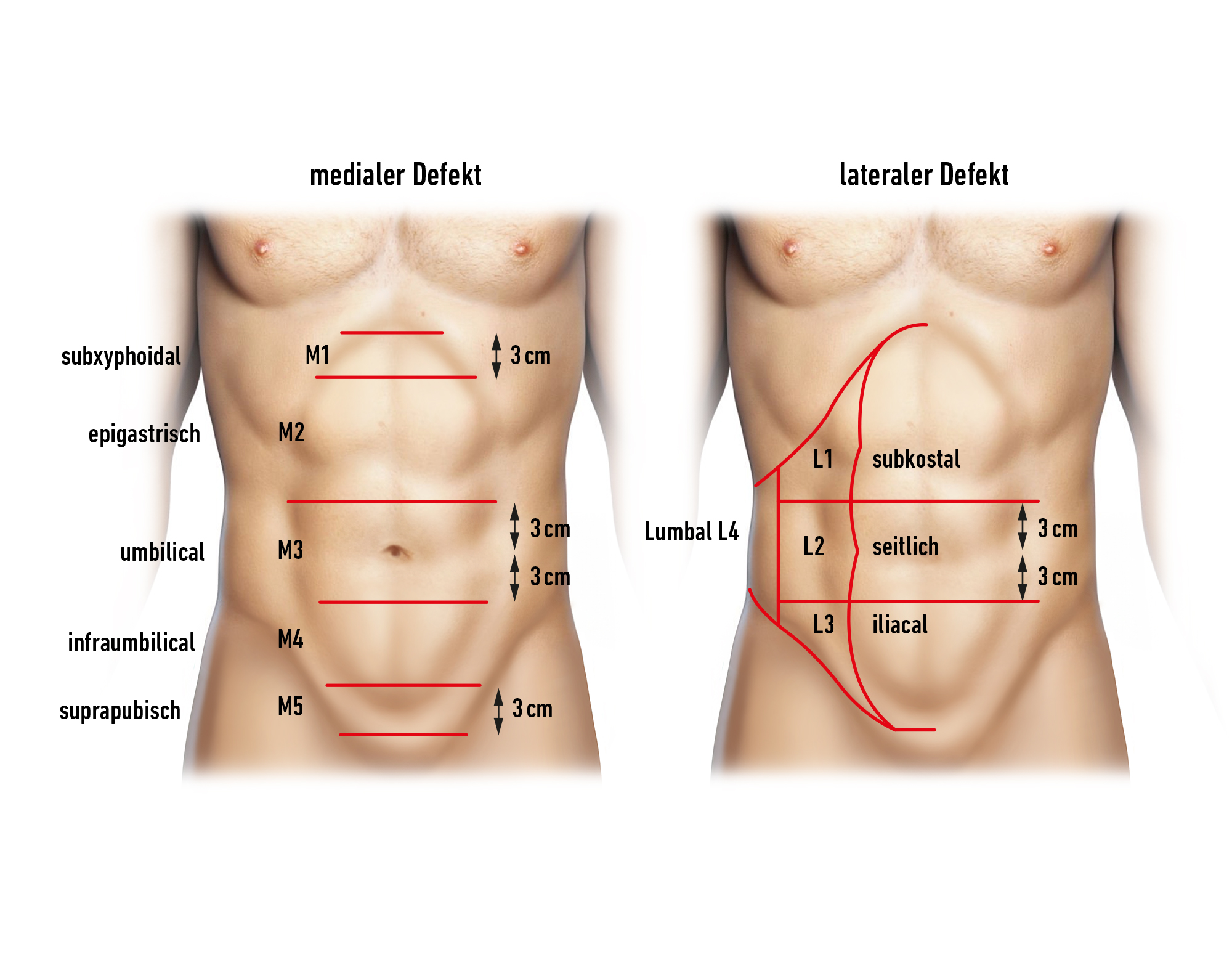Nach den Richtlinien der EHS und AHS wird die laparoskopische IPOM-Technik für größere primäre und sekundäre Bauchwandhernien und bei Patienten mit einem erhöhten Risiko für Wundkomplikationen empfohlen. Dies betrifft insbesondere Patienten mit Adipositas (BMI >_ 30) und Patienten mit einer Defektgröße von über 4 cm. Der Defekt sollte allerdings eine Größe von 8 - 10 cm nicht überschreiten.
Die laparoskopische intraperitoneale Netzimplantation stellt aktuell weltweit die häufigste endoskopische, minimal-invasive Technik zur Versorgung abdomineller Hernien dar. In Deutschland ist allerdings ein Rückgang dieser Methode aus Angst vor der Adhäsiogenität mit Ausbildung prothetointestinaler Fisteln trotz verbesserter Netze hinsichtlich ihrer Beschichtung zu verzeichnen. Weitere Gründe sind eine erhöhte Rate akuter und chronischer postoperativer Schmerzen vermutlich durch die Netzfixierung an der inneren Bauchdecke. Außerdem ist die Methode wegen des erheblichen Materialaufwandes teuer. Dennoch handelt es sich um eine wichtige Ausweichtechnik.
Sekundäre Bauchwandhernien
Die Narbenhernie ist die häufigste Komplikation nach Laparotomie mit einer Prävalenz zwischen 3 und 40 % unabhängig davon, welcher Bauchdeckenverschluss gewählt wird.
Risikofaktoren für die Narbenhernienentstehung:
BMI >_ 25, männliches Geschlecht, Rezidivinzision, maligne Erkrankung, Wundkontamination, offene OP, COPD, positive Familienanamnese.
Bei Indikationsstellung sollte der Voreingriff mindestens 6 Monate zurückliegen.
Bruchpfortenverschluss:
Es gibt Arbeiten, die einen zusätzlichen Verschluss der Bruchpforte beim IPOM empfehlen, um die Rate an Rezidiven, Serombildungen und Pseudorezidiven zu reduzieren. Dabei wird bei einem kleinen Defekt (< 3 cm) ein Direktverschluss des Defektes und bei größeren Defekten ein sog. LIRA (intrakorporale Rektusaponeuroblastie) mit einem knotenlosen Faden angewendet. In einer aktuellen Studie (Pizza F et al 2023) konnte die Überlegenheit eines Bruchpfortenverschlusses nicht bestätigt werden.